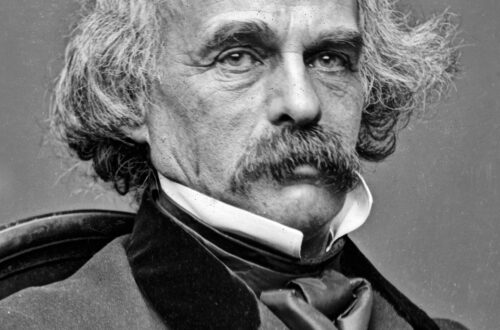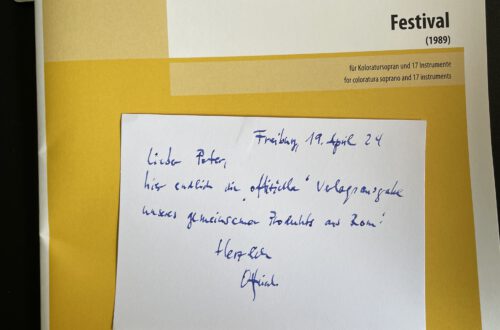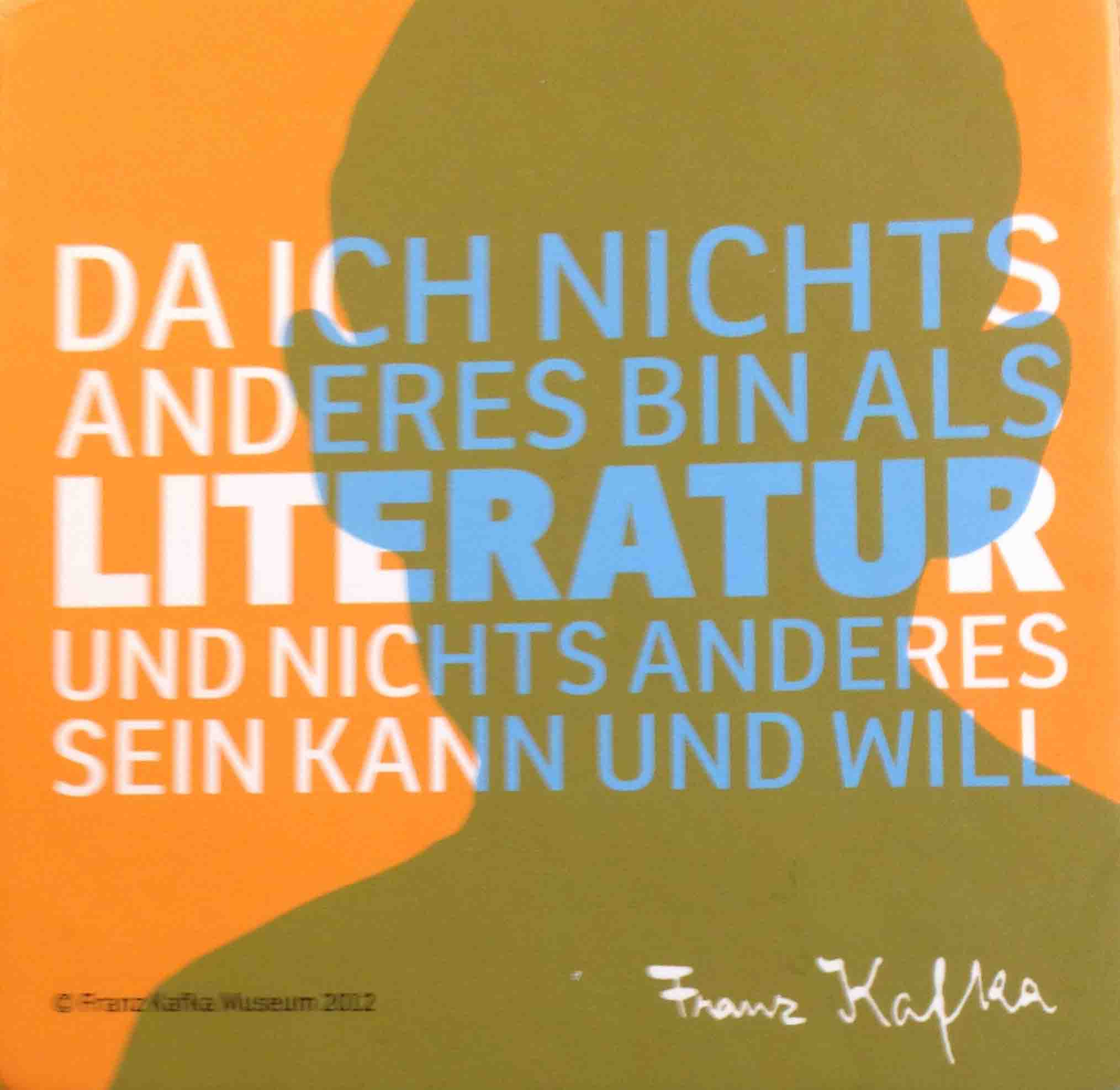
Nach der Sprache fragt nie jemand
Wiesbaden, 26. November 2014, bei Rossinis »Semiramide«
„Schreiben für eine Zeit,
die keine Bücher mehr hat.
Vielleicht auch keine Augen mehr.“
Hubert Fichte
Vor einigen Tagen bat mich eine Bekannte um Rat, da sie einen Krimi geschrieben hatte und wissen wollte, auf welche Weise sie jetzt weiter vorgehen solle. Es sei allerdings »kein großes Kunstwerk« geworden, fügte sie an. Ich konnte sie beruhigen und ihr Hoffnung machen, denn wenn es ein großes Kunstwerk wäre, so wäre es sicherlich unverkäuflich.
Kurz danach telefonierte ich mit meinem Verlag, weil die Verlegerin eine Frage hinsichtlich eines Lektorats hatte, mit dem sie sich plagt. Ich erinnerte mich daraufhin an einen Textstelle in Stephen Kings Buch »Das Leben und das Schreiben«, das ich im Jahr 2000 gelesen hatte. Unnütz zu sagen, dass ich die Stelle nicht fand; weiß der Teufel, was ich da mal wieder in meinem Kopf hatte. Dafür fand ich eine andere Stelle, die in seinem Vorwort steht. Er hatte nämlich die Kollegin Amy Tan gefragt, ob es eine Frage gebe, die ihr in Diskussionen nach einer Lesung noch niemals gestellt worden sei. »Die eine Frage, die nie aufgeworfen wird, wenn man vor einer Menge ehrfürchtiger Fans steht und so tut, als flöge einem alles zu. Amy hielt inne, dachte gründlich nach und sagte schließlich: ›Es fragt nie einer nach der Sprache.‹«
Das gab mir sehr zu denken, nicht deshalb freilich, weil ich es noch nicht gewusst hätte. Es war vielmehr etwas, was ich fast seit dem Beginn meines Schreibens immer wieder als Problem am Rande des Bewusstseins neben mir herschwimmen sehe und das mich einige Kraft kostet, um es zu verdrängen. Und wenn mir diese Verdrängung mal längere Zeit nicht gelingt, so folgt prompt das, was Hobbyautoren, die einfach zu wenig Disziplin und Sitzfleisch haben, gern kokett ihre »Schreibhemmung« nennen. Nur, dass es eben keine ist, denn ich habe noch niemals eine Schreibhemmung gehabt, was soll das auch sein. Was mich dann überfällt, das sind keine lächerlichen Schreibhemmungen, die könnte ich schlicht durch Schreiben jederzeit überwinden. Es ist vielmehr die pure Verzweiflung, der bodenlose Abgrund der Sinnlosigkeit.
Und das ausgerechnet wegen der Sprache?, werden Sie sich fragen, noch dazu da doch niemand über sie spricht. Ja genau, aber mir geht es eben anders als Stephen King. Ich werde nämlich durchaus auf die Sprache angesprochen. Und zwar von all denen, die finden, dass sie ihnen zu schwer sei. Das ist in aller Regel der einzige Grund, warum Lesern und Hörern Sprache überhaupt auffällt. Und jeder Lektor, der sein Handwerk versteht – will sagen, der es als seine Aufgabe ernst nimmt, für seinen Verlag verkäufliche Bücher zu produzieren – der wird dem Autor achselzuckend mitteilen, dass der Leser, sobald ihm die Sprache »auffällt«, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle aus der Lektüre aussteigt. Oder gar das Buch an die Wand wirft. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird er das Buch nicht weiterlesen. Und schon gar nicht wird er ein zweites von diesem Autor kaufen.
Darum ist Stephen Kings Vorwort-Passage etwas scheinheilig. Er weiß das natürlich ganz genau und hätte es sich nicht erst von Amy Tan sagen lassen müssen. Autoren wie Don DeLillo, schreibt er, werden nach der Sprache ihrer Bücher gefragt, Erfolgsautoren wie Amy und er selbst nicht. Jede/r Leser/in (nur um mir keine Männerfeindlichkeit vorwerfen lassen zu müssen, nicht um die zu vernachlässigenden Prozentzahlen Leser männlichen Geschlechts ernsthaft in Betracht zu ziehen), jede Leserin also kann jetzt einfach mal schnell überlegen, wie oft sie in den letzten zehn Jahren ein Buch von DeLillo und wieoft sie einen der allüberall bekannten Bestseller gelesen hat. Auch diejenigen, die für sich einen Außenseiterstandpunkt vertreten, werden zugeben, dass hier ein Problem sichtbar wird.
Nun könnte man darauf zwar reagieren, indem man den vor einigen Jahren noch sehr beliebten Sprachbrocken »Wen juckts?« aushustet, aber das wäre dann wie in dem Witz, in dem einem völlig mit Haschisch Zugedröhnten gesagt wird, dass Haschisch träge, faul und blöd macht. Und der Kerl antwortet nur. »Das find ich geil.«
Also, wenn Sie wissen wollen, wen es juckt, dann sage ich, mich juckt das, und ich weiß, dass es da einigen Kollegen ähnlich geht. Es juckt mich gehörig, verdammt nochmal, wenn ich mir beim Einlesen eines preisgekrönten Buches schon vom ketterauchenden Tontechniker sagen lassen muss, dass ich mir diesen Text gleich abschminken kann, da Konsumenten von Hörbüchern Sätze, die länger als fünf Wörter sind, nicht mehr verstehen. Die müssen doch schließlich beim Zuhören bügeln oder mit dem Auto fahren. Es juckt mich, wenn ich mir von einem Verleger, nachdem er ein Buch von mir unbedingt haben wollte, um sein Programm »literarisch aufzuwerten«, hernach verbal in den Hintern treten lassen muss, weil er meint, dass so Penner wie ich, mit ihren literarischen Ansprüchen und Auszeichnungen auf dem Buckel, eben zu blöd wären, um Bücher zu verkaufen.
Und immer so weiter. Endlos. Können Sie sich auch nur entfernt vorstellen, wie oft Manuskripte von mir abgelehnt wurden, weil sie sprachlich zu gut waren? Nein, das können Sie nicht. Dafür reicht Ihre Phantasie nicht. Das können nur Kollegen, die in der gleichen Lage sind. Und ich spreche von keinen Manuskripten, die ICH für gut hielt, sondern die Verlage. Ich habe das schriftlich. Ablehnungsschreiben, in denen mir z.B. mitgeteilt wird, das seien Texte wie von Harold Brodkey. Und der läge bei ihnen ja auch wie Blei auf Lager. Damals kannte ich den Namen Harold Brodkey noch nichtmal, befand mich also in einer Lage wie vermutlich Sie noch immer. Es war Anfang der 90ger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, inzwischen habe ich schon lange alles, was von Brodkey in Deutschland veröffentlich worden ist, gelesen. Und ich kann Ihnen sagen, der Lektor, der mir damals schrieb, war vermutlich auch der deutsche Lektor von Brodkey, doch war er ein Idiot. Brodkey ist nicht nur viel besser als ich, er ist vor allem auch ziemlich anders, um es mal etwas bedeckt zu sagen. Ich würde Brodkey sofort posthum den Nobelpreis geben. Für mich würde ich ihn, auch posthum, nicht einmal träumen.
Oder was halten Sie von einem Theaterverlag, der eines meiner Stücke mit dem Hinweis ablehnte, das solle ich an Steven Spielberg schicken; deutsche Theater könnten das nicht spielen. Wirklich? Natürlich nicht. Ich fand später eine Verlegerin dafür. Das Stück ist inzwischen auch vielfach mit Erfolg gespielt worden. In einem längst vergangenen Jahr erbrachten die Einspielergebnisse dieses Stücks in einem einzigen Monat sogar den größten Jahresverdienst, den ich bis dahin überhaupt hatte. Aber machen Sie sich keine überbordenden Vorstellungen, meine Einkünfte bei Steven Spielberg wären selbstverständlich vieltausendfach höher gewesen. Nehmen Sie das Beispiel nur als Hinweis auf die Kompetenz der Verleger oder Lektoren, die irgendwie ihre Ablehnungsschreiben herunterraspeln.
Nun egal, letztlich geht es mir längst nicht mehr um Niederlagen dieser Art, auch wenn ich, wie so mancher Kollege, damit Wände tapezieren könnte. Letztlich haben alle meine Texte bisher einen Verlag gefunden. Nur bei Theaterstücken, die über die sprachlichen Hürden hinaus auch noch meinen, sich deutschen Tabuthemen wie dem Holocaust annehmen zu müssen, ist das anders. Da bekommt man zum Beispiel vom Berliner Ensemble unter Peymann schon mal die Rückmeldung, es wäre schon erstaunlich wie sehr ich mich in meinem Text in die Bewusstseinslage eines Naziverbrechers einfühlen könne. Ob ich vielleicht selbst einer sei?
Schwamm drüber, auch wenn es im Grunde fast justiziabel wäre.
Letztlich geht es nur um eines, nämlich um die Sprache, von der ein kluger Mensch wie Stephen King sehr genau weiß, dass er sie in der gemeinten Weise nicht hat. Es wäre freilich ein Fehlschluss, wenn Sie jetzt denken, dass ich etwas gegen Stephen King hätte. Das ist nicht der Fall. Er ist sogar einer meiner Lieblingsautoren, und ich habe von ihm fast jedes Buch gelesen. Ebenso wie von Autoren wie Robert Harris oder den grandiosen Thrillern von Dennis Lehane. Aber zu meinen Lieblingsautoren gehören auch DeLillo, William Gaddis, Seamus Heaney, die unübertroffene Virginia Woolf, die für weibliche Leser der Gegenwart zehnfach zu schwierig ist, sorry Ladys, is leider so, Nabokov natürlich, mit allem, David Foster Wallace, inklusive seines Buches über Georg Cantor, Faulkner restlos, die Gedichte von Ted Hughes, John Hawkes, der seit etwa 50 Jahren vergessen ist und doch den Anfang der postmodernen amerikanischen Literatur nach Deutschland gebracht hat, Joyce, um einen der Urväter zu nennen, Henry James, A.L. Kennedy, ich liebe diese Frau!, Handke und Pynchon, William H. Gass, Mavis Gallant, Denis Johnson, Malcolm Lowry, – ich mache mal vorübergehend Schluss mit dieser Aufzählung und will nach all diesen Englisch/Amerikanischen Autoren gar nicht zum Rest der Welt kommen.
Über viele dieser Autoren bzw. ihre Texte habe ich selbst geschrieben, habe sie in Essays behandelt oder zumindest rezensiert, sie in Radiosendungen vorgestellt, als Vorlage für Drehbücher benutzt etc., ach, sie waren mir immer sehr nahe. Wie nahe, das merkte ich erst, als mir vor einigen Monaten, als ich in einem Gespräch über Bücher bzw. Autoren, die man besonders mag, von einer Bekannten, die ich eigentlich schätzte, vorgeworfen bekam, ich würde solche Autoren nur aus Eitelkeit anführen. Sie selbst kenne schließlich keinen einzigen davon. Das traf mich tief. Ihr Anwurf war in Wirklichkeit lächerlich und lediglich ihrer unverzeihlichen Unkenntnis geschuldet, doch hatte sie mich damit derart verletzt, dass ich sie aus der Liste meiner Bekannten strich und den Kontakt mit ihr abbrach.
Jeder normale Mensch wird nun sagen, dass das unangemessen ist, dass ich reagiert habe, als ginge es um etwas Lebenswichtiges, während es doch in Wirklichkeit nur um Bücher, um Literatur gehe, die allenfalls, wenn man sie überhaupt benötige, zur Unterhaltung zu gebrauchen sei. Und das war schon immer so.
Verstehen Sie mich also bitte nicht falsch, denn ich fahre hier auch nicht auf der Argumentationsschiene, dass das Problem der leider immer flacheren Gegenwart geschuldet sei, sowie dem restlos schamlosen Buchmarkt, der unentwegt erfolgreich sein Niveau zu senken bestrebt ist. Natürlich ist dem so, und der Buchmarkt produziert millionenfach »Beiß mich, wenn der Morgen graut«, aber das war schon immer so. Als Heinrich von Kleist (mal in der Schule von ihm gehört?) auf dem Weg nach Weimar war, um den Herrn von Jöte zu treffen, der ihn letztlich nicht nur nicht förderte, wie er naiv erhofft hatte, sondern auch noch ein Nagel zu seinem Sarg wurde, da machte er zwischendurch Halt in einer Stadt (damals reiste man lange, Pferdekutschen und so) und ging in eine öffentliche Bibliothek, um sich etwas Lektüre auszuleihen. Er fragte nach Goethe. Hamm wir nich. Er fragte nach Schiller. Hamm wir nich. Er vermied es schamvoll, nach eigenen Büchern zu fragen und fragte stattdessen nach Christoph Martin Wieland, dem bedeutendsten Dichter der Aufklärung in Deutschland. Ham wir nich. Ja, was sind denn das alles für Bücher, die da stehen? fragte er irritiert. Das sind alles Ritterromane, war die Antwort. Rechts die mit Gespenstern, links die ohne Gespenster.
Denken Sie bitte auf keinen Fall, dass ich über die Gegenwart, den Kulturverfall und ähnlichen Kram klage! Es ist gar nichts geschehen. Wir haben nur die Ritter und Gespenster gegen die Vampire, die Zwerge, die Orks usw. ausgetauscht. Und in einigen Bereichen der Genre-Literatur nicht mal das. Seien Sie zudem versichert, dass ich »Interview mit einem Vampir« für ein tolles Buch halte, sehr unterhaltend, wenn man die Zeit dafür hat. Auch die Verfilmung wird erst langweilig, sobald man sie ein zweites Mal anzuschauen versucht. Sie soll 50 Million Dollar gekostet und 283 Millionen Dollar eingespielt haben. Das hat keines meiner Bücher verdient, aber wer weiß, wenn man 50 Millionen dafür eingesetzt hätte? Einer der Filme, die nach Drehbüchern von mir realisiert wurden, hat knapp 2 Millionen gekostet. Regisseur und Produzent sind daran fast krepiert, aber na ja, das war zu einer Zeit, als im deutschen Film gerade mal wieder eine Flaute herrschte. Vielleicht wäre das heute anders. Außerdem rechne ich dem Regisseur sehr hoch an, dass er mir diesen Flop niemals zum Vorwurf gemacht hat. Na ja, er hatte selbst am Drehbuch mitgeschrieben.
Außerdem liebe ich den »Herrn der Ringe«. Ich war gerade kurz vor dem Abitur, als ich in einer Bremer Buchhandlung die erste englischsprachige Ausgabe in einem Schaufenster liegen sah. Ein dicker Paperbackband mit grünem Cover, der mich sofort interessierte, auf den ich mir aber keinen Reim machen konnte. Ich kaufte das Buch, zeigte es meinem Englischlehrer, der auch keinerlei Ahnung hatte, und wurde drei Tage danach krank. Ich lag zwei Wochen im Bett und las, na, was meinen Sie, den Herrn der Ringe natürlich, aber parallel dazu auch die »Ästhetik des Widerstands« von Peter Weiss. Dass ich dabei eines der Bücher gegen das andere auf- oder abgewertet hätte, kann ich mich nicht erinnern; lediglich einige der Passagen bei Peter Weiss, in denen Bert Brecht geschildert wurde, waren mir unangenehm, da mich Brechts Haltung enttäuschte.
Das scheint natürlich ein großes Durcheinander zu sein, was will uns der Gogolin über die Qualität von Literatur eigentlich erzählen. Verrate ich noch nicht. Und es wird erstmal sogar noch schlimmer, denn während ich als Kleinkind zu lesen begann, da standen Bücher wie »Sigismund Rüstig«, der deutsche Robinson, auf der Liste, danach »Todesflug nach Kalkutta« und »Heidi«. Ich bekam diese Bücher im Jahresabstand, jeweils zu Weihnachten. Meine Mutter hatte gute Verbindungen zu einer alten Frau, die eine Leihbücherei betrieb. Dort konnte man für ein paar Groschen dicke Wälzer von Serienkrimis und Wildwestromanen ausleihen, Tom Prox u.a. waren die Helden. Ich erinnere noch die kleinen blauen Datumsstempel, die bei der Ausleihe hinten ins Buch gedroschen wurden. Meine Mutter verschlang davon mitunter einen bis zwei pro Tag. Und die Bücher, die ich von dort zu Weihnachten bekam, die hatte sie verbilligt gekauft, da es Restexemplare waren. Das machte im Prinzip nichts, und an »Sigismund Rüstig« habe ich nach mehr als sechzig Jahren immer noch eine deutliche Erinnerung, vor allem wie sie die Palisaden errichteten, um sich gegen die Eindringlinge zur Wehr setzen zu können. »Todesflug nach Kalkutta« war dann eine ungeheure Enttäuschung, denn das Buch entpuppte sich als ein wirkliches Mängelexemplar, da es irgendwo nach der siebzigsten Seite einfach von vorn begann. Das war besonders ärgerlich für mich, da dass Flugzeug zum Zeitpunkt, da ich umblätterte und wieder von vorn beginnen musste, noch nicht abgestürzt war. Ich begriff erst sehr viel später, dass das meine erste Bekanntschaft mit einem Cliffhanger war, der freilich niemals aufgelöst wurde. Die armen Leute in der Maschine fliegen noch immer. Das zeigte mir, dass Spannung als solche einfach nicht ausreicht. Man lernt immer fürs Leben, gell.
Kurz gesagt, ich bin nicht mit der sogenannten Weltliteratur in der Wiege zum Leben erwacht. Das muss man auch nicht, denn das Problem ist ein anderes. Es entsteht, wenn wir lediglich zum Vergnügen, zum Zeitvertreib, zur Unterhaltung lesen. Denn wenn wir so lesen, dann wird uns jedes etwas schwierigere Buch den Spaß verderben. Und wenn die Schwierigkeit nicht nur im möglichen Thema sondern – oh Graus! – auch noch in einer Sprache besteht, die einen höheren Komplexitätsgrad besitzt als gemeinhin gewohnt, dann wird das für den Leser, der auf Unterhaltung aus ist, zu schwer, wird regelrecht zur Arbeit, die er naturgemäß nicht bereit ist zu leisten. Er sieht das Problem freilich nie bei sich, er lastet es dem idiotischen Autor an, der für sein Gefühl eine ungenießbare Sprache zu benutzen scheint. Und so lange man lediglich zum Vergnügen liest, kann sich dies auch gar nicht ändern. Man müsste dafür wieder begreifen, dass Lektüre, die sich lohnt, eben kein Zeitvertreib ist sondern eine Lebenserfahrung, die, wie jede Lebenserfahrung, Anstrengung von uns verlangt. Lektüre ist nicht dazu da, uns zu zerstreuen, sie fordert vielmehr Konzentration von uns, fordert Arbeit. Das ist in einer Welt, die auf möglichst schnelle Bedürfnisbefriedigung angelegt ist, natürlich gar nicht mehr zu vermitteln. Und die wenigen Autoren, die an ihre Leser noch derartige Ansprüche stellen, die sterben jetzt eh langsam aus. Man wird als Leser also künftig immer weniger in dieser Weise belästigt werden.
So, das wars, da wollte ich hin, denn ich finde es ätzend, wenn ich einen Text nicht mit einem positiven Ausblick abschließen kann. Leben Sie für heute wohl. Ich wünsche allen nur das Beste.
Bleiben Sie glücklich, wünscht
Ihr PHG