
Durch die Form (DIE FORM!) – mit Thomas Tranströmer, Nabokov und den anderen
Venedig, Montag, 30. Oktober 2017, bei Wagners Rheingold, unter Wilhelm Furtwängler und dem Orchestra Sinfonica e Coro della Radion Italiana, in einer Aufnahme vom 26. Oktober 1953 – also fast so lang her wie mein Leben dauert und aus einer der wenigen Ring-Einspielungen Furtwänglers, die sich überhaupt erhalten haben.
In der Nacht erwachte ich oft, augenscheinlich, weil ich im Traum und auch in den Wachphasen dazwischen gedanklich permanent an einem Text arbeitete. Ich war so sehr damit befasst, dass ich über lange Strecken den Eindruck hatte, gar nicht zu schlafen. Ich weiß nicht mit Sicherheit, woran es letztlich lag, vielleicht daran, dass ich den Eindruck hatte, mit der Niederschrift des Textes bereits im Rückstand zu sein. Dann aber auch daran, dass ich immer wieder die Frage nach der Form drehte und wendete. Damit meine ich sowohl die Form des Textes selbst, den ich zu behandeln gedenke, dann aber auch die Form meines Textes, mit dem ich darauf antworten möchte.
Am Morgen war ich etwas müde, doch haderte ich nicht mit mir, da ich es als sehr positiv betrachtete, dass ich mich mit meinem Stoff bereits im Traum so intensiv befasse, besser gesagt, dass sich mein Gehirn so intensiv befasst, denn eine bewusste Entscheidung war ja nicht dabei. Und dann, als ich beim Frühstück saß, stieß ich bei meiner Lektüre gegen Ende des schmalen Bandes „Die Erinnerungen sehen mich an“ von Tomas Tranströmer auf die Stelle, an der er sich an seinen Latein-Unterricht in der Schule erinnert.
Er habe die Differenz zwischen dem Klapprig-Trivialen der schülerhaften Übersetzungen und dem aus sich selbst leuchtenden römischen Text so deutlich empfunden, dass es ihm vorkam, als sei er (der Text) auf die Erde heruntergeholt worden. Und dann begriff er, was er da gefunden hatte.
Er schreibt: Es waren die Bedingungen der Poesie. Es waren die Bedingungen des Lebens. Durch die Form (DIE FORM!) konnte etwas angehoben werden. Die Raupenfüße waren weg, die Flügel entfalteten sich.
Dies zu lesen war wie eine gar nicht kleine Erschütterung für mich. Erstens, da ich mich unerwartet belohnt fühlte, weil die wie zufällig gewählte Frühstückslektüre mir mit dem Bezug auf die „Form“ so deutlich eine Korrespondenz zum Thema meiner nächtlichen Träume präsentierte. Und zweitens weil es das ist, worum ich mich ständig bemühe, im eigenen Schreiben, im eigenen Lesen und selbstverständlich auch, wenn ich das Schreiben unterrichte.
Was jetzt? Nun, dass die hässlichen Raupenfüße verschwinden und die Sprache endlich ihre Schmetterlingsflügel entfaltet!
Natürlich gelingt das nicht immer. Im eigenen Schreiben kann ich mich darum bemühen. Und wenn ich beharrlich bleibe, so werde ich immer wieder den Punkt erreichen, an dem ich spüre, wie die „Form“ gelingt und in den Text fließt. Weitaus seltener komme ich in meiner Lektüre zu diesem Ziel, denn selbst Texte, die ich früher sehr bewundert habe, enttäuschen mich heute, weil ich all die Stellen finde, an denen sie nicht klingen, stumpf dahertappen und sich so quasi selbst von dem Podest stoßen, auf den meine einstige Bewunderung sie gestellt hatte. Gerade die letzten zwei Jahre waren voll von solchen Ernüchterungen. Im Grunde haben sich nur Proust, Joyce und Nabokov bei erneuter Lektüre ganz und gar bewährt. Von Nabokov las ich im Frühjahr innerhalb von knapp drei Wochen vier seiner frühen Romane (Maschenka/König, Dame, Bube/Lushins Verteidigung und Der Späher) neu und kam mir dabei unentwegt wie beschenkt vor. Nabokov hat in so hohem Maße ein Bewusstsein für die Form, dass es kaum zu überbieten ist.
Am schlechtesten gelingt es mir, dieses Bewusstsein zu wecken, wenn ich das Schreiben unterrichte. Das hängt damit zusammen, dass das Schreiben nichts Äußerliches ist. Es ist vielmehr ein körperlicher Akt, und wenn man den Text, an dem man schreibt, nicht körperlich zu empfinden vermag, wenn man nicht spürt, dass Wörter, Satzteile und Sätze einen Rhythmus haben (müssen oder zumindest sollten), wenn man das Auf- und Ab der Silben nicht mit dem inneren Ohr wahrzunehmen vermag, wenn man das unterschiedliche Tempo von Texten nicht körperlich als Bewegung erfühlt, ach, wenn man das Helle und das Dunkle der Sprache nicht ’sehen‘ kann, dann ist die Sprache halt dazu verurteilt, auf hässlichen Raupenfüßen daherzustolpern. Leider gibt es kaum noch jemanden, vor allem, wenn es jüngere Leute sind, die mit dem Schreiben erst beginnen, der einen körperlichen Zugang zur Sprache besitzt. Er muss z.B. durch intensive Lektüre erworben werden; doch wer liest heute noch. Selbst die, die schreiben wollen, sind so abgrundtief überheblich, dass ihnen das Lesen gar nicht einfällt.
Nun gut, aber man darf die Hoffnung nicht verlieren, das meint auch Tranströmer. Und ich nehme es mir immer wieder aufs Neue vor. Für Sie wünsche ich es mir.
Und, dass Sie glücklich bleiben, natürlich
Ihr PHG


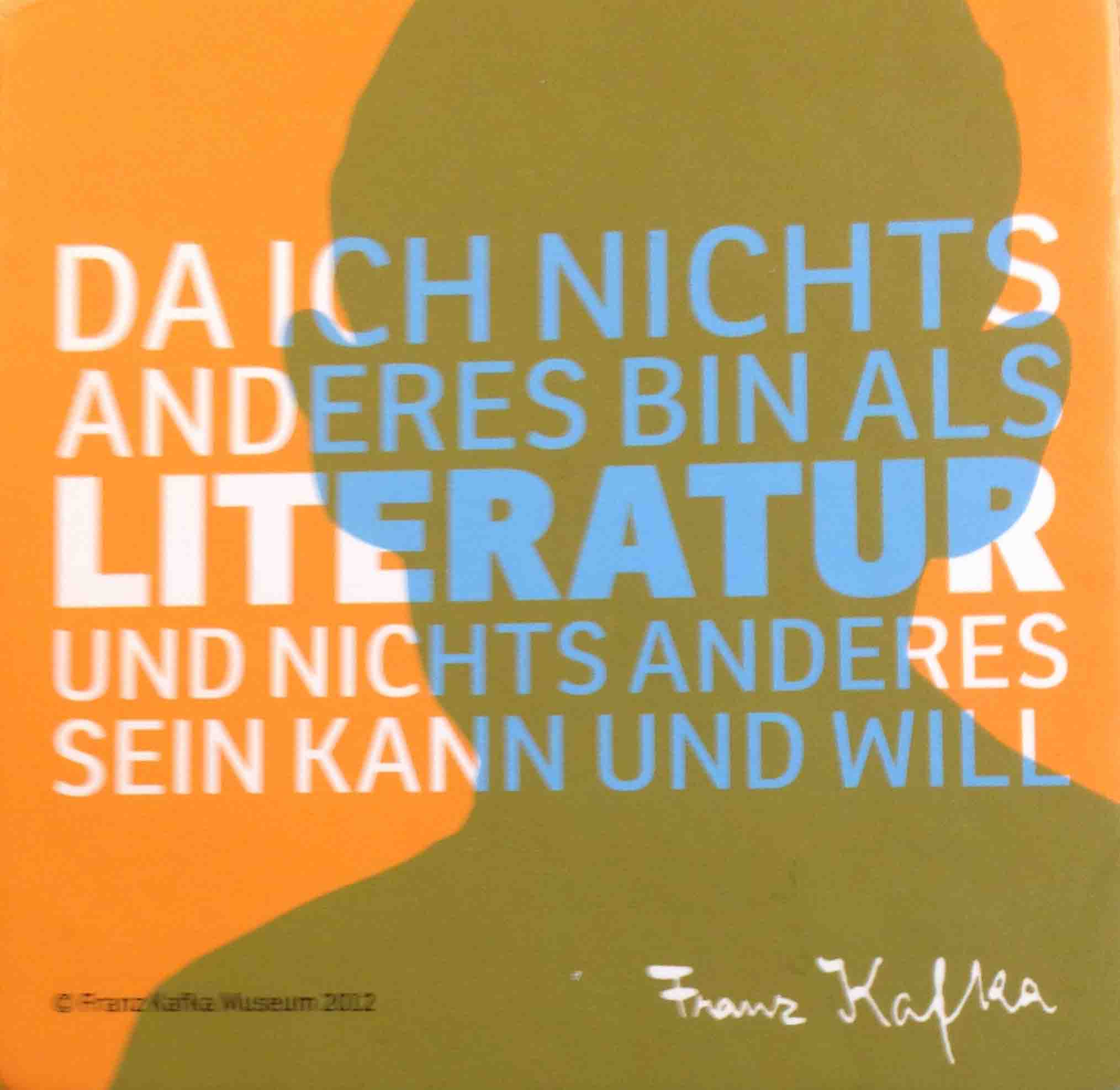

2 Kommentare
Ralph Roger Glöckler
Du bringst es auf den Punkt, lieber Peter. Der Text muss durch uns atmen und wir mit ihm – nur so kann er abheben und fliegen!
admin
Darum war ich ja so erfreut, lieber Ralph, als ich sah, dass Du ein hohes Bewusstsein für die sprachliche Form hast.
Dazu vielleicht auch interessant: https://www.peter-gogolin.de/?p=3407